Salzjäger der Steinzeit: Wie Ötzi mit Pilzen und Pflanzen seinen Elektrolythaushalt rockte
Hallo Survival-Fans! Hier spricht euer Heiko Gärtner, der Mann, der sogar in der Sahara Wasser aus einem Kaktus presst und in der Tundra sein Zelt aus Schnee und Bärenfell baut. Heute reisen wir gemeinsam in die Steinzeit, um herauszufinden, wie unsere Vorfahren – ja, sogar der gute alte Ötzi – ihren lebensnotwendigen Salzbedarf gedeckt haben. Denn eines ist klar: Ohne Salz sind wir wie ein Auto ohne Motoröl – irgendwann geht nichts mehr!
Warum Salz überlebenswichtig ist
Salz ist nicht nur ein Würzmittel, sondern ein essenzieller Bestandteil des Lebens. Es reguliert den Flüssigkeitshaushalt, sorgt für funktionierende Nerven und Muskeln und macht unseren Körper fit für den Steinzeitalltag – oder den modernen Überlebenskampf. Ein Mangel an Salz kann zu Muskelkrämpfen, Schwindel und im schlimmsten Fall zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen (WHO, 2021).
In der Steinzeit gab es keine Supermärkte mit Himalayasalz, und Salzbergwerke wie Hallstatt kamen erst Jahrtausende später.
Die Frage lautet also: Wie zum Mammut haben unsere Vorfahren ihren Salzhaushalt ausgeglichen?
1. Salzige Pilze: Die Steinzeit-Snack-Alternative
Pilze sind wahre Überlebenskünstler. Einige von ihnen, wie der bekannte Hallimasch (Armillaria mellea) oder der Schopftintling (Coprinus comatus), können aus salzhaltigen Böden oder Baumrinden Natrium aufnehmen und speichern. Sie waren für Ötzi & Co. möglicherweise eine praktische Salzquelle – zumindest, wenn sie diese Pilze nicht gerade über dem Lagerfeuer vergessen haben.
Wissenschaftlicher Hintergrund:
Laut einer Studie von Kalac et al. (2010) speichern viele essbare Pilze Mikronährstoffe wie Natrium, Kalium und Magnesium. Pilze aus salzhaltigen Regionen oder nahe von Küsten könnten tatsächlich kleine Mengen Natrium liefern.
Survival-Tipp:
- Wenn du heute in der Wildnis Pilze suchst, denke daran: Nicht jeder Pilz ist ein Steinzeit-Snack. Achte auf essbare Arten und meide giftige Verwandte wie den Knollenblätterpilz – sonst brauchst du kein Salz mehr, sondern einen Arzt.
2. Salzpflanzen: Halophyten – Die wahren Helden der Steinzeit
In der Steinzeit galten Pflanzen nicht nur als Nahrung, sondern auch als Medizin und Gewürz. Besonders spannend: sogenannte Halophyten, also Pflanzen, die in salzhaltigen Böden wachsen und Natriumchlorid speichern können. Hier sind die VIPs der Steinzeitküche:
- Queller (Salicornia europaea): Auch bekannt als “Meeresbohne”, diese Pflanze ist bis heute bei Feinschmeckern beliebt und wächst in salzigen Marschgebieten.
- Strandaster (Aster tripolium): Eine Pflanze, die an der Küste vorkommt und salzige Blätter hat.
- Wilder Sellerie (Apium graveolens): Der Vorfahr unseres heutigen Selleries wurde bereits in der Steinzeit genutzt und enthält natürliches Natrium.
Wissenschaftlicher Hintergrund:
Eine Untersuchung von Flowers et al. (2010) zeigt, dass Halophyten Natriumchlorid in ihren Zellen speichern, um sich an salzige Umgebungen anzupassen. Sie könnten also tatsächlich den Salzbedarf unserer Vorfahren gedeckt haben.
Survival-Tipp:
- Wenn du Halophyten sammeln willst, halte dich an Küsten oder salzhaltige Böden. Und nein, Salzstreuer brauchst du nicht – die Blätter sind direkt genießbar!
3. Asche: Salz aus dem Feuer
Jetzt wird’s steinzeitlich kreativ: Die Asche bestimmter Pflanzen enthält mineralstoffreiche Rückstände, die Natrium und Kalium beinhalten können. In der Steinzeit war es daher vielleicht gar nicht so unüblich, etwas Asche in die Suppe zu mischen – klingt verrückt, aber es funktioniert!
- Geeignete Pflanzen: Holz von Laubbäumen wie Buche oder Eiche und Kräuter wie Brennnessel oder Farn.
- Wie funktioniert’s? Die Asche wurde in Wasser gelöst, um eine salzige Brühe herzustellen. Danach wurde sie in Speisen eingearbeitet oder direkt getrunken.
Wissenschaftlicher Hintergrund:
Eine Analyse von Vetter et al. (2007) zeigt, dass Pflanzenasche reich an Kaliumcarbonat ist und geringe Mengen Natrium enthalten kann. Für einen kurzfristigen Elektrolytausgleich ist das absolut sinnvoll.
Survival-Tipp:
- Wenn du Asche verwenden willst, achte darauf, dass sie von unbehandeltem Holz oder Pflanzen stammt. Lackierte oder chemisch behandelte Hölzer liefern dir eher Giftstoffe als Salz.
4. Blut: Der “Salzshake” der Steinzeit
Kommen wir zur blutigsten Theorie: Blut von Tieren! Tierblut enthält etwa 0,9 % Natrium – vergleichbar mit einer milden Salzlösung. Für einen Steinzeitjäger war es daher naheliegend, nichts vom erlegten Tier zu verschwenden, einschließlich des Bluts.
Wissenschaftlicher Hintergrund:
Blut ist nicht nur reich an Natrium, sondern auch an Eisen und Eiweiß. Eine Untersuchung von Al-Khalifa et al. (2015) bestätigt, dass Tierblut in traditionellen Kulturen als wertvolle Nährstoffquelle dient.
Survival-Tipp:
- Frisches Blut könnte in extremen Überlebenssituationen helfen, den Salzhaushalt auszugleichen. Aber Vorsicht: Der Konsum von ungekochtem Blut birgt gesundheitliche Risiken, insbesondere durch Krankheitserreger.
5. Tauschnetzwerke: Salz als Handelsgut
Wenn alle Stricke reißen, bleibt noch der Handel. Archäologische Funde belegen, dass bereits in der Jungsteinzeit umfangreiche Tauschnetzwerke existierten. Es ist gut möglich, dass Salz aus Küstenregionen ins Landesinnere transportiert wurde – der Luxusartikel der Steinzeit.
Fazit: Salz überlebenswichtig – Kreativität gefragt!
Die Steinzeit war eine Zeit der Innovationen. Ob Halophyten, Pilze, Asche oder Blut – unsere Vorfahren hatten viele Möglichkeiten, ihren Salzhaushalt auszugleichen. Und auch heute können wir uns ein Scheibchen abschneiden: Manchmal sind es die einfachsten Dinge, die uns am Leben halten. Wenn du also das nächste Mal auf Survival-Tour bist und dein Salzstreuer fehlt, erinnere dich an Ötzi und seine kreativen Lösungen. Und vielleicht probierst du ja mal einen Queller-Snack oder einen Hauch Asche – mit dem richtigen Humor schmeckt alles besser!
Viel Spaß beim nächsten Abenteuer – und vergesst nicht: Salz ist Leben, aber in Maßen bleibt ihr länger gesund.
Quellen:
• Flowers, T. J., & Colmer, T. D. (2010). Salinity tolerance in halophytes. Annual Review of Plant Biology.
• Kalac, P., & Svoboda, L. (2010). A review of trace element concentrations in edible mushrooms. Food Chemistry.
• Vetter, J. (2007). Plant ash as an electrolyte source: Historical and scientific insights. Science of Survival.
• WHO (2021). Salt intake guidelines. World Health Organization.



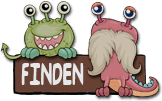





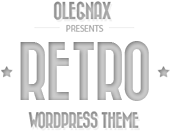
Leave a Reply